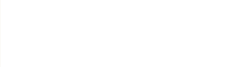Alte Sagen, wilde Geschichten: Was wir heute brauchen
Essay im Programmheft zur Ausstellung "Zur frohen Aussicht" vom 29.6. bis 20.9. in Ernen VS
Hohe Berge, tiefe Täler und mittendrin die liebliche Landschaft des Oberwalliser Bergdorfs Ernen mit seinen dunklen Holzhäusern, seiner Barockkirche, seinen Gärten und Plätzen. Hier weitet sich der Blick –hinunter ins Rhonetal und hoch hinauf zu den Viertausendern des Aletschgebiets. «Geschichten wachsen nicht zufällig an bestimmten Orten», schreibt die Schriftstellerin Eveline Hasler, und dies gilt besonders für diese Landschaft. Keinen Augenblick zweifle ich daran, dass hier jedem Felsen und jedem Baum Geschichten warten, die erzählt werden wollen.
Die Geschichte hinter den Geschichten
Aufgewachsen in den Walliser Bergen, war ich schon als Kind vertraut mit den Sagen und Mythen einer urwüchsigen Landschaft. Dann aber sind andere Geschichten für mich wichtig geworden: die von den notwendigen und sogenannt nützlichen Dingen des Lebens.
Nach langen Jahren fernab vom Wallis und seinen Erzählungen, trat eines Tages ganz unerwartet eine Sagengestalt in mein Leben: Die alte Schmidtja, von der berichtet wird, dass sie in einer Hütte nahe beim Gletscher am Spinnrad sitzt und mit den Seelen kommuniziert. Und das tat sie denn auch mit meiner. Es war Zeit, mich bewusst wieder anzuschliessen an meine Walliser Herkunft, an meine Kindheit in den Bergen, an meine damalige Vertrautheit mit all den Wesen, von denen in den Sagen erzählt wird.
So sass ich als Erwachsene oft wieder auf meinem Tschuggu, einem runden, vom Gletscher geschliffenen Felsblock, nahe der Alphütte meiner Grossmutter. Es war der Lieblingsplatz meiner Kindheit. Hier konnte ich den Wolkendrachen zuschauen oder eintauchen in das Reich der Flechten, Moose, Blumen und Käfer, die den Felsen bewohnten. Hier lebten auch die Sagengestalten, von denen uns Kindern des Abends erzählt wurde.
Jahrzehnte später war ich nun mit meinen Büchern da und las die alten Sagen gegen den Strich. Widersprüche zeigten sich, Risse taten sich auf und der Tschuggu brachte mich in Verbindung mit besonderen Felsformationen in vielen Ländern. Ich habe sie besucht, ihren Melodien gelauscht, ihre Geschichte erforscht und Geschichten gesammelt, die sich um sie ranken. Sagen erzählen von ihnen und von den Menschen, denen sie mehr bedeuteten als totes Gestein. Es enthüllte sich mir eine Mensch-Natur-Beziehung, in der alles als belebt und miteinander verbunden erfahren wird – durchdrungen von einer mächtigen Urkraft, einem schöpferischen Prinzip, das die Menschen in verschiedensten frühen Kulturen oft in weiblicher Gestalt wahrnahmen.
Den Spuren dieses ursprünglichen Weltverständnisses, in der die Natur als beseelt erkannt und in ihren weiblichen Qualitäten respektiert und verehrt wird, wollte ich nachgehen. So begann ich, in den Walliser Sagen nach Frauengestalten zu suchen. Ich entdeckte vorerst farblose, hässliche, lächerliche Wesen: bösartige Hexen, büssende Sünderinnen, fromme Heilige. Sie hatten mir auf den ersten Blick nichts zu sagen. Und doch erahnte ich eine verborgene Kraft.
Sagen gehören verschiedenen Kulturschichten an. Sie sind während Jahrzehnten, oft während Jahrhunderten mündlich weitergegeben und immer wieder neu erzählt worden. Im Wallis haben Pfarrherren sie erst im 19. Jahrhundert aufgeschrieben. Diese Verschriftlichung hat die alten Geschichten einerseits vor dem Vergessen bewahrt, andererseits in einer bestimmten Form erstarren lassen: als moralisierende Erzählungen voller Warnungen, Sünde, Schuld und Bestrafung. Doch viele von ihnen lassen sich von den christlichen, patriarchalen, rationalen Zurechtbiegungen befreien. Solche Überformungen können Schicht für Schicht abgetragen werden, und oft zeigt sich bei diesem Vorgang ein innerer Kern, ein Wissen, das Kraft und Sinn vermittelt – auch in unserer Gegenwart.
Auf diese Weise habe ich ein Stück verdrängte Frauenkulturgeschichte freigelegt. Kraftvolle Gestalten kamen zum Vorschein, solche, die um ein Leben mit den natürlichen Rhythmen und Zyklen wussten, um die Kraft der Gemeinschaft, um die Hilfe der Jenseitigen und die Meisterinnen darin waren, sich und die ihren durch harte Zeiten zu bringen. Hinter den aufgelösten einengenden Denkstrukturen zeigten sich mir lebensförderliche Geschichten.
Sagen sind lebendig
Es lohnt sich also, der mythischen Betrachtungsweise zu trauen und dem Fluss der Lebensenergie durch die Generationen zu folgen. Altes Wissen aus einer Tiefe zu holen, die nicht den Zeitströmungen unterworfen ist, und es mit den Erfahrungen des Heute wieder aufzunehmen – dies scheint mir ein stärkender Weg zu sein. Er bringt viel Wurzelkraft für die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen.
Auf diese Weise können Sagen sich wieder mit Bedeutung füllen. Natürlich gibt es Widerstand gegen einen solchen Umgang mit dem alten Erzählgut. Für manche gilt wohl: Sagen sind wie heilige Schriften unantastbar. Doch längst haben im Wallis Erzählerinnen, Erzähler und andere Kulturschaffende die alten Strukturen aufgebrochen. Und mit viel Spiellust erwachen an Erzählabenden, in Konzerten, Filmen und Theatern die althergebrachten Geschichten zu neuem Leben.
Auch die Tourismusbranche hat die Sagenwelt für sich entdeckt: So ist der Rollibock, das furchterregende Sagentier aus dem Aletschgebiet, zu einer Art Umweltschützer geworden. Und die Sagenhexe vom Natischer Berg ist die Hauptfigur des alljährlich durchgeführten Hexen-Skirennens auf der Belalp. Gern werden Wanderwege zu Schauplätzen der Sagen geführt. Manchmal leider mit wenig Feingefühl und Sorgfalt, denn es kann schon vorkommen, dass an einem uralten Kultfelsen ein Klettergarten angebracht wird und in einer mythischen Höhle noch immer die Konservendosen-Deponie aus dem 20. Jahrhundert dahinrostet.
So dienen die alten Sagen den einen zur Werbung, den anderen zur Unterhaltung und dann gibt es solche, die sie als Ausgangspunkt für philosophische Höhenflüge nutzen. Eines ist sicher: Sie sind mehr als Geschichten, die uns die Griime machen, Gänsehaut-Momente erzeugen sollen – obwohl dies immer noch als Qualitätsmerkmal gilt.
Sagen sind ein wichtiger Teil unseres immateriellen Kulturgutes, verbinden uns mit denjenigen, die vor uns das Land bewohnt haben und auf geheimnisvolle Weise auch mit denen, die nach uns kommen. Wir tun gut daran, diese Geschichten aufmerksam zu lesen, sie zu würdigen und für uns neu zu gestalten.
Das Sich-Sagen-Erzählen war immer schon ein lebendiger Prozess, zu vergleichen mit einem alten, wertvollen Tuch, das von Menschen verschiedener Generationen gesponnen, gefärbt, gewebt, geflickt, aufgetrennt und neu vernäht wird. In der oralen Tradition werden die Sagen immer wieder frisch kundgetan – einer neuen Zeit, Umwelt und Zuhörerschaft angepasst.
Mit den Steinen tanzen
Die alten Geschichten aus einer zeitgenössischen Perspektive neu interpretieren – genau dies tun die jungen Kunstschaffenden David Dragan und Noah Kohlbrenner mit ihrem Team. Mit der Videoarbeit Stones and their Whispers of old Stories erforschen sie Sagen und die mystische Dimension von Landschaften in Transsilvanien und den Walliser Alpen. . Das 2025 fertiggestellte Werk wird im Rahmen der Ausstellung Zur frohen Aussicht in Ernen in einem kleinen Speicher in intimer Atmosphäre gezeigt.
Das Video beginnt mit langsam dahinziehenden Wolken. Ich reise mit ihnen, werde aus der Hast meines Alltags herausgehoben, gleite hinüber in einen Raum, der sich auf einen wilden Bergbach inmitten von Felstrümmern öffnet. Ein Tosen, ein Zischen – Zeitlosigkeit beginnt. Grüne Feenfäden im sanft dahinströmenden Wasser. Alles .
Tanzende Wesen transportieren alte Geschichten in die Gegenwart, werden selbst zu Geistern im Naturreich. Sind sie Steine, die zu Tale donnern oder sind es Zwerge, die da zwischen moosbedeckten Felsen werken und wirken?
Dann, Winterstarre in den Bergen. Ein vereister Bergsee, uralte Lärchen im tiefen Schnee. Ein pulsierendes Dröhnen, als dränge es aus dem Boden und anschwellende, sphärische Musik. Das grosse Atmen beginnt. Wesen erwachen, sind Keimlinge, die aus dem Boden schiessen und sich dem Frühling auf hingeben. Und zugleich tanzen sie die alten Geschichten der eingefrorenen Büssenden im Gletscher weg.
Sie tanzen, damit die Fülle des Lebens sich entfaltet, damit die Erde fruchtbar bleibt. Schöpfungsgeschehen ist ein fortwährender Prozess, bei dem sich Menschen seit frühester Zeit immer wieder in Ritualen den tieferen Dimensionen des Seins öffnen, um sich bewusst einzubinden in die Rhythmen und Zyklen des Lebens und in die Gemeinschaft der gesamten Mitwelt. Leben mitgestalten – die tanzenden Wesen in der Dämmerung der sommerlichen Karpaten erinnern daran.
Den Naturgeistern Dank und eine Gabe hinterlassen, eine Bitte, einen Wunsch formulieren, eine Frage stellen, orakeln – kleine Rituale, die eine Art Ehrerbietung bedeuten. Wir geben etwas von uns für das, was wir erhalten, damit die Erde im Gleichgewicht bleibt. Daraus entsteht ein lebendiger Kreislauf des gegenseitigen Nährens von Natur und Mensch. Auch die Ahnenwesen sind freigebig. Doch es braucht ein Handreichen auf beiden Ebenen der Wirklichkeit, so erzählt eine Sage.
Krisenzeiten überstehen, die Kräfte der Natur beschwören und die Hilfe der Jenseitigen anfordern – von alters her sind Orte bekannt, die sich für solche Magie als besonders günstig erweisen. Doch dann gilt es, die gerufenen Geister in Schach zu halten, auch den Rausch, das Überborden. In Trance den wilden Kräften begegnen, sie lenken – zum Wohl des grossen Ganzen – und immer wieder in Balance kommen.
Ein Lawinenhang, eine Gruppe von flüchtenden Menschen. Oder ist es eine Prozession Betender, der Gratzug der Totengeister? Oder doch bloss ein Ausflug der Sportlichen mit ihren Schneeschuhen? Das Verwirrspiel im Reich der Sagen ist vielfältig. Der rastlose Aufstieg auf den höchsten Gipfel endet abrupt. Eine seltsame Gestalt steht da auf einer Anhöhe, ein Mischwesen, erschreckend und harmlos zugleich. Ist es besänftigend oder ratlos, gar verwirrt? Oder ist es doch ein Mensch, der kopflos die Spitze errungen hat?
Der Film endet mit der Aufnahme eines aufrechtstehenden Felsblocks. Ein Hüter der Landschaft und wie ein Mahnmal, das fortdauert, wenn Menschenwesen längst von diesem Planeten verschwunden sind.
Der Film erforscht die Landschaft aus einer archaischen Erfahrung und Sichtweise heraus. Er kommt mit wenigen Worten aus, denn Erzählkunst heisst hier, , der Bäume, des Wasserfalls und der Erde zuzuhören und mitzutanzen im grossen Reigen des Lebendigen. Damit wird unser gemeinsames Hiersein bekräftigt, unsere Verwandtschaft und Gleichwertigkeit – die Verwobenheit im Netz des Lebens. Das gelingt nur, wenn wir, wie die Filmemachenden, mit der Natur in Verbindung gehen.
Der Film ist ein stilles Werk, das mich innerlich in Bewegung und zum Nachsinnen bringt. Walliser Alpen und Karpaten, Winter und Sommer – letztlich zeigt der Film die und Transformationskraft des Naturreichs. Wir können diese als uralte Form von Bewusstsein erleben und in ihr und in uns selbst etwas Ewiges erahnen, das sich kaum benennen lässt. In beeindruckenden Bildern wird erzählt vom grossen Geheimnis des Werdens und Vergehens. Und ich bleibe dabei nicht staunende Beobachterin, ich lausche mit allen Sinnen und Übersinnen, werde selbst zum Teil der Geschichte.
Welche Geschichten brauchen wir heute?
Längst hat das Storytelling, die Kunst des Geschichtenerzählens, in der Kommunikation eine zentrale Rolle eingenommen. Es wird in vielen Bereichen eingesetzt – von der Geschäftswelt bis hin zu Bildung, Kultur und Politik. Von einer guten Geschichte kann es abhängen, ob eine Kampagne, ein Anliegen oder ein Anlass erfolgreich ist oder übersehen wird.
Geschichten sprechen die Menschen auf verschiedenen Ebenen an. Sie können Wissen und Botschaften transportieren, Menschen etwas lehren und sie berühren. Eine durchlebte Geschichte kann eine Aktion anstossen oder Veränderung herbeiführen. Auch davon erzählen die alten Sagen.
Mir wird klar: die Welt ist eine fortlaufende Schöpfungsgeschichte und wir schreiben sie mit. In heutigen Zeiten müssen wir alte Sicherheiten hinter uns lassen und neue Wege finden. Dazu können Geschichten ermutigen und helfen, den Filter unserer Weltsicht – und sei es nur für einen kurzen Moment – durchlässig werden lassen. Sie können neue Horizonte des Verstehens und Seins eröffnen. Wir können Geschichten finden, die nähren und befruchten, die anstiften zu Lebensfreude und Zuversicht, zu Wertschätzung, Fürsorge und wirkmächtigem Tun. Und solche, die uns empfänglich machen für unsere Verbundenheit mit dem Netz des Lebens um uns herum. Ganz so, wie es dem Film Stones and their Whispers of old Stories gelingt.
Welche Geschichten sind in uns wirksam? Was erzählen sie über die Erde, den Kosmos, die Menschheit, uns selbst und unser Handeln? Welche Erzählungen enthalten den Schlüssel für ein gutes, gelingendes Leben für alle Wesen?
Lassen wir uns inspirieren von Ernen, dem kleinen Bergdorf, das in den Sommermonaten seine besondere Magie entfaltet, vom Wirken der jungen Kunstschaffenden, von den Menschen, Wesenskräften und den lebendigen Geschichten, die hier wohnen.
Ursula Walser-Biffiger